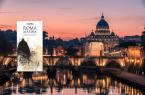Ein Tor am Scheideweg der Geschichte
Perfekt eingebettet in die Aurelianischen Mauern, die zu den größten und am besten erhaltenen Befestigungsanlagen der antiken Welt gehören, bildet ein schlichter und eleganter, von Türmen flankierter Travertinbogen die Trennlinie an einer befahrenen Kreuzung zwischen der Villa Borghese und der Via Veneto, der symbolträchtigen Straße des La Dolce Vita. Es handelt sich um die Porta Pinciana, eines der wenigen Tore in Rom, das sein ursprüngliches Aussehen über die Zeit hinweg bewahrt hat, abgesehen von den seitlichen Bögen, die in der Neuzeit aus Gründen des Straßenverkehrs geöffnet wurden. Ende des 3. Jahrhunderts (d. h. zur Zeit der Errichtung der Stadtmauern durch Kaiser Aurelian) war das Tor noch eine „Posterula“, ein kleiner Fußgängerdurchgang ohne besondere Bedeutung. Kaum ein Jahrhundert später jedoch hatte die immer stärker werdende Bedrohung durch die Barbaren den Kaiser Honorius davon überzeugt, die gesamte Mauer zu erhöhen und die Tore zu verstärken, indem er an den fehlenden Stellen, wie an der Porta Pinciana oder der Porta Asinaria, Verteidigungstürme, Zinnen und Wachposten anbrachte. Mit seinen zwei neuen runden und seltsam asymmetrischen Türmen und seiner Lage auf dem Pincio-Hügel sollte sich das Tor zumindest bei einer Gelegenheit als strategisch wichtig erweisen, nämlich bei der gescheiterten Belagerung der Stadt durch die Ostgoten von Witichis.
Pinciana, Salaria, Turata, Belisaria...
Der Name leitet sich von der gens Pincia ab, die im 4. Jahrhundert den Hügel besaß, an dessen steilen Hängen das Tor stand. Im Laufe der Jahrhunderte hatte das Tor aber auch andere Namen: Porta Salaria Vetus, weil hier die antike „Salzstraße“ begann, die vielleicht schon vor der Gründung Roms zurückverfolgt werden kann, oder Porta Turata, weil es im Laufe seiner langen Geschichte mehrmals ummauert wurde, zum Beispiel im 8. Jahrhundert und im Jahr 1808. Die mittelalterliche Volkstradition gab ihr auch den Namen „Porta Belisaria“. Historisch gesehen ist das Tor in der Tat eng mit dem byzantinischen Feldherrn Belisarius verbunden, der zwischen 537 und 538 während des langen griechisch-gotischen Krieges entlang dieses Mauerabschnitts einen Angriffsversuch des von Witichis angeführten Heeres auf die Stadt abwehrte. Die griechischen und lateinischen Kreuze, die in die Schlusssteine außerhalb und innerhalb des Bogens eingemeißelt sind, könnten ebenfalls aus dieser Zeit stammen und darauf hinweisen, dass die lateinische Stadt von einem byzantinischen Heer verteidigt wurde. Eine glückliche Legende aus dem Mittelalter besagt, dass Belisarius, der wegen seiner Teilnahme an einer Verschwörung gegen Kaiser Justinian in Ungnade gefallen war, seines Besitzes beraubt und geblendet wurde, seine letzten Jahre in Rom verbrachte und an der Schwelle des Tores bettelte, das der Mittelpunkt seines Ruhmes gewesen war. Als Beweis für diese Geschichte war bis ins 19. Jahrhundert eine Graffiti-Inschrift an der Tür zu sehen, die lautete „date obolum Belisario“ (gib Belisarius eine Münze), ein Satz, der sprichwörtlich für die Vergänglichkeit des Ruhms wurde und im 18. Jahrhundert auch in dem berühmten Gemälde „Belisarius bittet um Almosen“ des französischen Malers Jacques-Louis David aufgegriffen wurde.
Von Belisarius zu Christo
Belisarius (oder Alexander dem Großen) war vielleicht auch die riesige Marmorbüste gewidmet, die wir heute noch in einer Nische unweit des Tors bewundern können. Vor der Eröffnung der Via Veneto und dem Bau des sie umgebenden Viertels diente die Skulptur als Hintergrund für eine der breiten Alleen der spektakulären Villa Ludovisi, die kurz nach der Einigung Italiens auf dem Altar der Bauspekulation geopfert wurde. Die Villa war im 17. Jahrhundert von Kardinal Ludovico Ludovisi, dem Neffen von Papst Gregor XV., erbaut worden, und ihre Gärten säumten den Mauerabschnitt um das Tor, der aus Sicht des Stadtverkehrs nie besonders wichtig war. Seit Ende des 19. Jahrhunderts beherbergte der Mauerweg von der Porta Pinciana bis zur Porta Salaria (die 2021 wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde) Ateliers und Künstlerwohnungen, zum Beispiel die von Ettore Ferrari, dem Autor des Denkmals für Giordano Bruno auf dem Campo de’ Fiori. Das eigentümlichste Experiment war jedoch das des Keramikers Francesco Randone, der 1890 im Turm XXXIX in der Via Campania eine „kostenlose Schule für Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis fünfzehn Jahren, ohne Unterschied der Klasse, der Religion oder der Kultur“ eröffnete: die Scuola d’Arte Educatrice, die heute noch in Betrieb ist. Im Januar 1974 war das Tor schließlich vierzig Tage lang Protagonist einer spektakulären Land-Art-Intervention. In vier Tagen umhüllten die Künstler Christo und Jeanne-Claude de Guillebon beide Seiten der Mauern mit Nylontüchern und orangefarbenen Seilen in einer ihrer berühmten temporären „Verhüllungen“, die den Blicken entzogen und die Realität für einen Moment veränderten, um dem Betrachter ein neues Bewusstsein zu vermitteln.
Foto turismoroma
Informationen
 Condividi
Condividi
Location
Um mehr über alle barrierefreien Dienste zu erfahren, besuchen Sie den Abschnitt barrierefreies Rom.