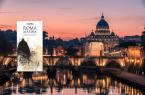Es handelt sich um den größten derzeit sichtbaren Komplex aus der republikanischen Zeit mit den Überresten von vier Tempeln aus dem 4. bis 2. Jahrhundert v. Chr., die gemeinhin mit den ersten vier Buchstaben des Alphabets bezeichnet werden, da ihre Identifizierung noch nicht ganz sicher ist. Der Name des Platzes, in dessen Mitte sie stehen, leitet sich von Argentoratum, dem heutigen Straßburg, ab, der Herkunftsstadt von Johannes Burckardt (ital. Giovanni Burcardo), dem Zeremonienmeister von Alexander VI. Borgia, der den zu seinem Palast in der Via del Sudario gehörenden Turm „Argentina“ nannte; dieser wurde im 19. Jahrhundert abgetragen und ist heute nicht mehr zu erkennen.
Der Heilige Bereich wurde 1926 bei den Abrissarbeiten der Altstadt für den Bau neuer Gebäude entdeckt und bis 1928 ausgegraben, mit mehreren Wiederaufnahmen bis mindestens in die 1970er Jahre. Das älteste Gebäude ist der Tempel C, der zwischen dem Ende des 4. und dem Beginn des 3. Jahrhunderts v. Chr. auf dem primitiven Bodenniveau errichtet wurde und wahrscheinlich der Göttin Feronia gewidmet war, einem Kult, der seinen Ursprung in Sabina hatte. Auf der gleichen Ebene wie dieser Tempel wurde in der Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. der kleinere Tempel A errichtet, der wahrscheinlich der Iuturna geweiht war.
Zu Beginn des 2. Jahrhunderts v. Chr. wurde der Tempel D gebaut, der größte der vier Tempel, der den Lares Permarini oder, nach anderen Hypothesen, den Nymphen gewidmet war. Wahrscheinlich nach dem verheerenden Brand von 111 v. Chr. wurde für die drei Tempel ein einziger Tuffsteinboden geschaffen, der auf einer dicken Schuttschicht lag, die den gesamten Platz um mehr als einen Meter anhob. In diese Phase fällt der Bau des Tempels B, des einzigen Tempels mit kreisförmigem Grundriss. Die meisten Gelehrten identifizieren ihn mit dem Tempel der Fortuna huiusce diei, der „Fortuna der Gegenwart“, der zur Feier des Sieges der Römer über die Kimbern von Viterbo errichtet wurde. Die Widmung an eine weibliche Gottheit scheint durch den grandiosen Akrolithen (eine Statue mit Kopf und nackten Teilen aus Marmor, der Rest aus Bronze oder anderem Material) bestätigt zu werden, von dem heute Fragmente im Museum Centrale Montemartini aufbewahrt werden.
Im Jahr 80 n. Chr. verwüstete ein weiterer Großbrand einen großen Teil des Campus Martius, darunter auch den Heiligen Bereich, der unter Kaiser Domitian erneut umgestaltet wurde. Die Trümmer wurden eingeebnet und der noch heute sichtbare Travertinplattenbelag wurde darauf errichtet. Nach dem 5. Jahrhundert begann wahrscheinlich der Prozess der Aufgabe und Umgestaltung der Gebäude, und das Gebiet wurde möglicherweise von einem Klosterkomplex eingenommen. Zwischen dem 8. und 9. Jahrhundert n. Chr. wurden imposante Strukturen, möglicherweise Adelshäuser, in großen Tuffsteinblöcken errichtet.
Ebenfalls aus dem 9. Jahrhundert stammen die frühesten Belege für die Errichtung einer Kirche innerhalb des Tempels A, die 1132 dem Heiligen Nikolaus geweiht wurde. Aus dem 12. Jahrhundert stammen die Apsis, die mit einer Heiligenfigur verziert ist, der kosmische Fußboden und der Altar. Die kleine Apsis auf der linken Seite der Kirche stammt aus dem 14. Jahrhundert.
Im Inneren des archäologischen Komplexes, hinter den Tempeln B und C, befindet sich ein großer Tuffsteinkeller, der zur Kurie des Pompeius gehörte, in der die Sitzungen des römischen Senats stattfanden und in der Julius Cäsar an den Iden des März, dem 15. März 44 v. Chr., erstochen wurde.
Informationen
Tuesday-Sunday
9.30 to 19.00 from the last Sunday in March to the last Saturday in October
9.30 to 16.00 from the last Sunday in October to the last Saturday in March
Last admission one hour before closing
24 and 31 December 9.30 to 14.00
1 January 2025 from 11.00 to 16.00
Closed Mondays, 25 December and 1 May
Ticket office and bookshop at the Torre del Papito piazza dei Calcarari.
The archaeological area is accessible to all.
Toilets not available
 Condividi
Condividi
Location
Um mehr über alle barrierefreien Dienste zu erfahren, besuchen Sie den Abschnitt barrierefreies Rom.